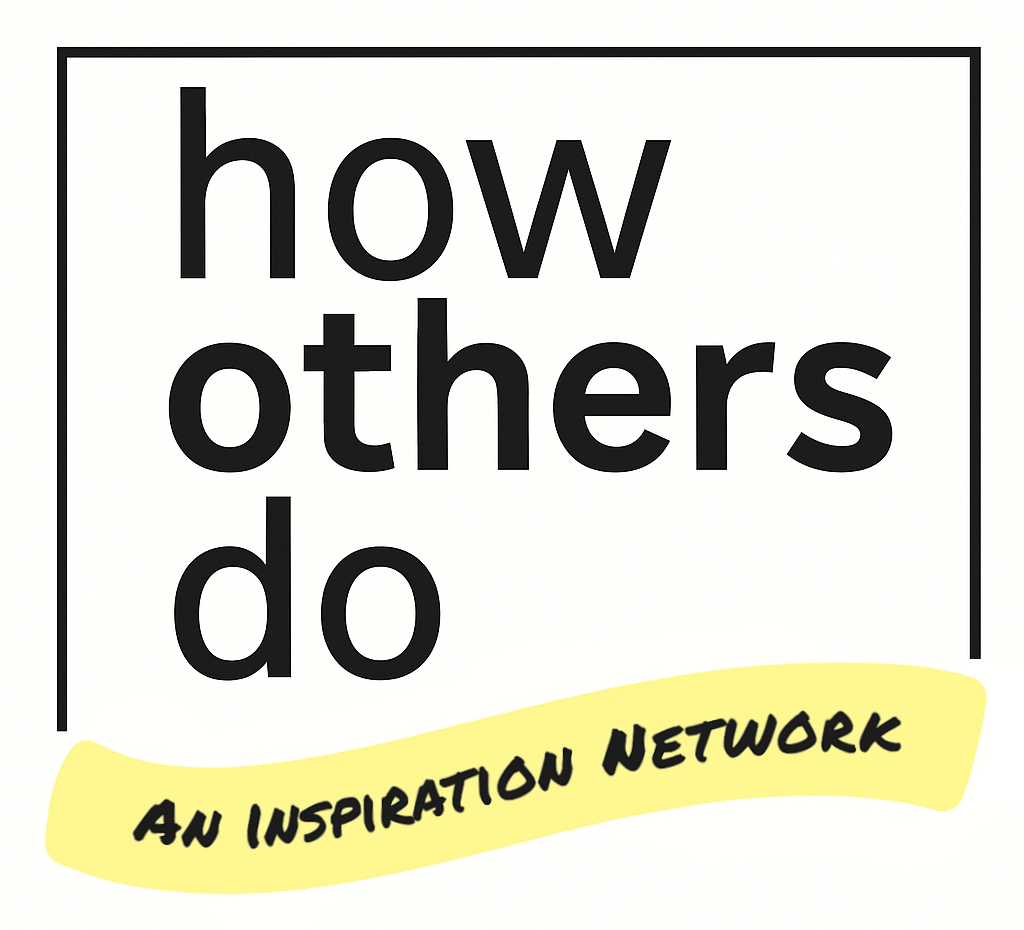Wenn Abteilungen mehr Mauern als Brücken bauen, leidet Zusammenarbeit, Geschwindigkeit und am Ende der Kunde.
Silostrukturen sind das „Betriebssystem“ vieler Unternehmen. Über Jahrzehnte als bewährtes Modell etabliert, heute jedoch immer öfter Ursache von Blockaden und Ineffizienz. Abteilungen sind klar voneinander getrennt, Kommunikation läuft vertikal über die Hierarchie und jede Einheit optimiert ihre eigene Welt.
Das Ergebnis: Abteilungen und Teams arbeiten nebeneinander statt miteinander.
Typische Symptome von Silostrukturen
Wer genau hinschaut, erkennt wiederkehrende Muster:
- Unkoordinierte Handlungen: Jede Abteilung verfolgt ihre Agenda, Kommunikation findet fast nur bereichsintern statt.
- Wissensinseln: Wissen bleibt in der Abteilung oder wird doppelt aufgebaut – ein teurer Luxus.
- Zielkonflikte: Bereiche arbeiten auf unterschiedliche Vorgaben hin, was Gesamtziele verwässert.
- Verantwortungsvermeidung: Niemand übernimmt End-to-End-Verantwortung, Zuständigkeiten werden lieber weitergereicht.
- Mühsame Abstimmungen: Bereichsübergreifende Meetings sind aufreibend, zeitintensiv und oft konfliktgeladen.
Die Folgen spürt man im Tagesgeschäft: Projekte verzögern sich, Prioritäten sind unklar, Kundenfeedback wird zu spät berücksichtigt und am Ende gewinnt die Bürokratie, nicht der Kunde.
Warum Silostrukturen so hartnäckig bleiben
Trotz der offenkundigen Nachteile halten viele Organisationen an diesem Modell fest. Gründe gibt es viele:
- Historische Prägung: Jahrzehntelang galt die funktionale Organisation als Synonym für Effizienz.
- Führungskultur: Zentralistische Steuerung wird als notwendig erachtet, um „Kontrolle“ zu behalten.
- Angst vor Kontrollverlust: Autonomie für Teams wird oft gleichgesetzt mit Kontrollverlust für Führungskräfte.
- Fehlender Mut: Transformation wird als riskant und teuer wahrgenommen – also verwaltet man lieber das Bestehende.
- Mangelndes unternehmerisches Denken: Bereichsleiter steuern „ihr“ Budget, aber niemand trägt Verantwortung für den Gesamterfolg.
Ein zentrales Missverständnis
Viele Führungskräfte sind überzeugt, dass Organisationen zentralistisch gesteuert werden müssen, sonst drohe Chaos. Tatsächlich entsteht Chaos aber gerade durch die Vielzahl paralleler Einzelsteuerungen: jede Abteilung zieht an ihrem Strang, aber selten in die gleiche Richtung.
Besonders kontraproduktiv wirkt die Trennung von Change und Run. Entwicklungsprojekte werden vom Tagesbetrieb entkoppelt. Häufig mit der Folge, dass Lösungen zwar „fertiggestellt“, aber nicht nachhaltig weiterentwickelt und betrieben werden. Diese künstliche Spaltung führt zu Reibungsverlusten, Übergabeproblemen und fehlender Verantwortung.
Fazit
Silostrukturen sind kein „notwendiges Übel“, sondern ein systemischer Bremsklotz. Sie verhindern Geschwindigkeit, Innovation und Zusammenarbeit. Wer sie beibehält, riskiert nicht nur Ineffizienz, sondern auch Wettbewerbsfähigkeit.
Genau hier setzt Flow Orientierung an: Es beschreibt die systematischen Hypothesen hinter diesem Muster und hilft, die Mechanismen zu erkennen. Denn nur wer das Problem klar versteht, kann auch wirksame Alternativen entwickeln. Lies hierzu und zu unserem Solution Pattern #1 – Flow Orientierung in unserem nächsten Blogartikel „Flow-Orientierung: Arbeit vom Kundenbedarf her neu denken“