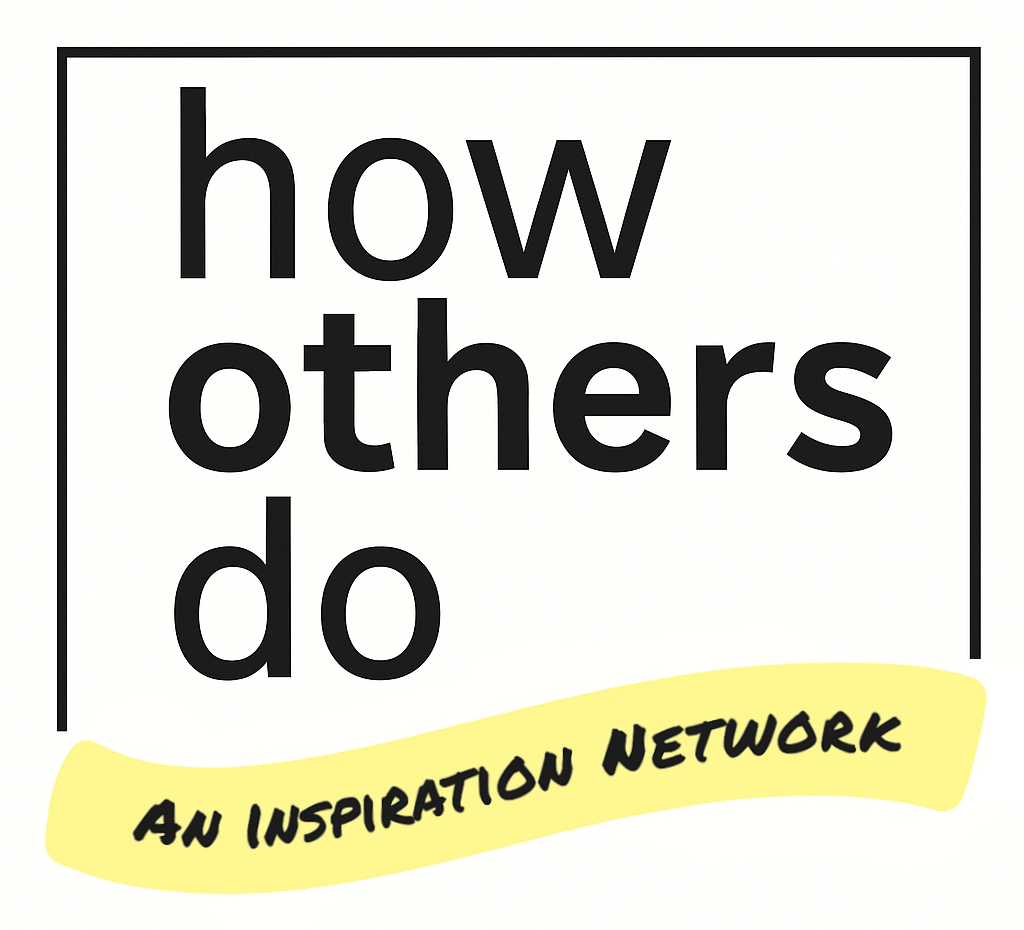Demand Management
Damit Anforderungen nicht nur gehört, sondern auch wirksam werden
In vielen Organisationen landen ständig neue Anforderungen auf dem Tisch – mal konkret, mal diffus. Es gibt viele Ideen, viele Erwartungen, viele „Müssen-wir-dringend-machen“-Themen. Was fehlt: Überblick, Priorisierung und ein gemeinsames Verständnis dafür, was wirklich gebraucht wird und was wann dran ist.
Worum geht’s bei diesem Pattern?
Systematisches Demand Management sorgt für Klarheit im Umgang mit Anforderungen: Was ist das tatsächliche Bedürfnis? Wie dringend und relevant ist es? Und wie passt es zu unseren strategischen Zielen und Ressourcen?
Es schafft einen gemeinsamen Prozess vom ersten Impuls bis zur Umsetzungsentscheidung und schafft Transparenz über offene Bedarfe, deren Bewertung und den aktuellen Stand.
Demand Management wird oft mit Anforderungs- oder Portfoliomanagement verwechselt. Dabei übernimmt jede Ebene eine eigene Rolle:
- Projektportfoliomanagement (strategisch/“Flight Level 3″): Priorisiert Initiativen gemäß strategischer Ziele.
- Demand Management (koordinativ/taktisch/“Flight Level 2″): Sammelt, bewertet und qualifiziert Veränderungsbedarfe.
- Anforderungsmanagement (operativ/“Flight Level 1″): Übersetzt beschlossene Vorhaben in umsetzbare Anforderungen.
Nur wenn diese drei Ebenen miteinander verzahnt sind, gelingt echte Wirkung.
Demandmanagement bildet den zentralen Teil des sogenannten Upstream-Prozesses: Anforderungen werden hier gesammelt, aufbereitet, bewertet und periodisiert bevor sie in die Umsetzung gehen. Erst danach folgt der Downstream-Prozess, in dem die Umsetzungsteams qualifizierte Anforderungen per Pull-Prinzip übernehmen und bearbeiten.
Das Zusammenspiel beider Bereiche sorgt für klare Übergaben, realistische Planung und dafür, dass nicht alles gleichzeitig „durch die Tür gedrückt wird“.
Was dieses Muster bewirkt
Mit systematischem Demand Management arbeitet ihr wirksamer:
- Klarheit: Was wirklich gebraucht wird – und was eher Wunschdenken ist.
- Fokus: Anforderungen werden bewertet und priorisiert – nicht einfach nur gesammelt.
- Struktur: Es gibt einen gemeinsamen Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten.
- Übersicht: Backlogs und Bedarfe sind nachvollziehbar, nicht verstreut.
- Entlastung: Weniger „Projekte ohne Auftrag“, weniger Unklarheit beim Sprintbeginn, weniger Diskussion, mehr Umsetzung.
Typische Anwendungssituationen
Dieses Pattern hilft, wenn…
- …die Anforderungen nie enden aber nichts wirklich vorankommt.
- …Projekte starten, obwohl niemand den Bedarf wirklich versteht.
- …Teams überlastet sind, weil sie alles gleichzeitig machen sollen.
- …niemand den Überblick hat, was eigentlich entschieden wurde und warum.
Was braucht es, damit es wirkt?
Damit Demandmanagement funktioniert, braucht ihr:
- Ein zentrales, transparentes Backlog zur Steuerung.
- Klare Rollen und Verantwortlichkeiten (z. B. Demand Manager, Product Owner).
- Gemeinsame, transparente Kriterien zur Priorisierung.
- Verbindliche Kadenzen (Regel-Events zur Bewertung und Planung).
- Gute Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, IT und Management.
- Tooling, das Klarheit schafft und Prozesse unterstützt (nicht behindert).
- eine eindeutige Definition of Ready (DoR): Anforderungen sind erst umsetzungsreif, wenn klar definierte Kriterien erfüllt sind.
Methoden, Frameworks & Modelle
Diese helfen euch dabei, Anforderungen sichtbar zu machen, zu strukturieren und in Entscheidungen zu überführen:
- Backlog-Management: Zur systematischen Sammlung, Priorisierung und Fortschrittsverfolgung von Anforderungen.
- Impact/Effort-Matrix: Für eine pragmatische Bewertung und Priorisierung.
- Lean Portfolio Management: Für strategische Steuerung über alle Vorhaben hinweg – mit Fokus auf Wert.
- Flight Levels: Zur Verbindung von Bedarfen auf operativer, koordinierender und strategischer Ebene.
- Obeya: Als visuelles Steuerungssystem für Anforderungen, Ressourcen und Umsetzungsstatus.
- SAFe (Scaled Agile Framework): Zur Integration von Demand-Management in agilen skalierten Organisationen – etwa durch Lean Portfolio Kanban.
Was dieses Pattern nicht ist
Demandmanagement ist keine „Sammelbox“ für Wünsche oder ein weiteres Kontroll-Tool. Es geht nicht darum, möglichst viel einzusammeln sondern darum, bewusst zu entscheiden, was wirklich umgesetzt wird und was nicht. Wer Anforderungen unreflektiert weitergibt, verliert Fokus und Effizienz.
Verwandte Solution Patterns
- SP1: Flow-Orientierung – Ein strukturierter Demandprozess verhindert, dass Anforderungen ungefiltert im System landen. Dieses Pattern sorgt für klaren Fluss; von der Idee bis zur Umsetzung.
- SP2: Strategie-Alignment – Nicht jeder Wunsch wird umgesetzt sondern nur das, was zur Strategie passt. Dieses Pattern sorgt für Orientierung bei Priorisierungen.
- SP5: Klare Rollen & Zuständigkeiten Damit Demand Management funktioniert, müssen Rollen und Verantwortungen klar geregelt sein. Dieses Pattern schafft die nötige Struktur.
Praxisbeispiel: Von der Wunschliste zur wirksamen Steuerung
Die für Business Intelligence und Data Warehousing zuständige Einheit eines Unternehmens mit rund 6000 Mitarbeitenden stand vor einer wachsenden Herausforderung: Zahlreiche Stakeholder, sehr unterschiedliche Anforderungen, unklare Prioritäten und ein limitierter Personalkörper. Anforderungen waren oft interpretierbar, teils widersprüchlich, teils nicht umsetzbar.
Die Lösung: Aufbau eines strukturierten Demand Managements bestehend aus fünf Kernelementen:
- Einführung eines zentralen Backlogs, um Anforderungen sichtbar zu machen.
- Ganzheitliche Kapazitätsplanung, um realistisch zu planen und Ressourcen besser einzusetzen.
- Etablierung einer klaren Backlog-Owner-Rolle (Product Management) zur Steuerung der Anforderungen.
- Einführung regelmäßiger Kadenzen (Planungstaktung) für mehr Steuerbarkeit.
- Regelmäßige Refinements und Big-Room-Planungen mit allen relevanten Stakeholdern zur Priorisierung und Abstimmung.
Kritisch für den Erfolg war: Fachbereiche und IT wurden ganzheitlich eingebunden, das Modell wurde gemeinsam entwickelt auch mit kontroversen Diskussionen. Das Senior Management war aktiv beteiligt und übernahm Verantwortung in schwierigen Priorisierungsfragen.
Das Ergebnis: weniger Ad-hoc-Anfragen, klarere Entscheidungen, bessere Auslastung und deutlich mehr Zufriedenheit bei Teams und Stakeholdern.
Eine ausführliche Beschreibung dieses Praxisbeispiels findest du in diesem Blogbeitrag.
Wie KI unterstützen kann
Ein gutes Demand Management lebt von Klarheit, Struktur – und dem richtigen Fokus. Genau hier kann Künstliche Intelligenz helfen:
- Anforderungsklassifikation: KI kann eingehende Bedarfe automatisch thematisch clustern, etwa nach Businessziel, Reifegrad oder betroffenen Systemen.
- Priorisierungsvorschläge: Basierend auf bisherigen Entscheidungen, Aufwand/Nutzen-Verhältnissen oder strategischer Relevanz kann KI helfen, eine erste Priorisierung abzuleiten.
- Duplicate Detection & Similarity Matching: KI erkennt ähnliche oder doppelte Anforderungen im Backlog bevor Aufwand in parallele Arbeit fließt.
- Qualitätscheck für Anforderungen: LLMs können Textbausteine prüfen: Ist das Ziel klar? Fehlen relevante Angaben? Gibt es Widersprüche?
- Übersetzung von Fachsprache in technische Anforderungen: KI kann bei der Übertragung von Business Needs in technische Konzepte unterstützen, z. B. durch semantische Umschreibungen oder Vorschläge.
- Ganzheitliche Kapazitäts- und Budgetsteuerung: Durch die Auswertung von Daten aus Tools wie Jira, PPM-Systemen und Ticketsystemen kann KI Muster erkennen, Ressourcenengpässe sichtbar machen und die Planung auf Portfolioebene unterstützen.
Der Vorteil: KI hilft, das Demand Management schneller, konsistenter und skalierbarer zu machen ohne die Verantwortung für Entscheidungen abzugeben.