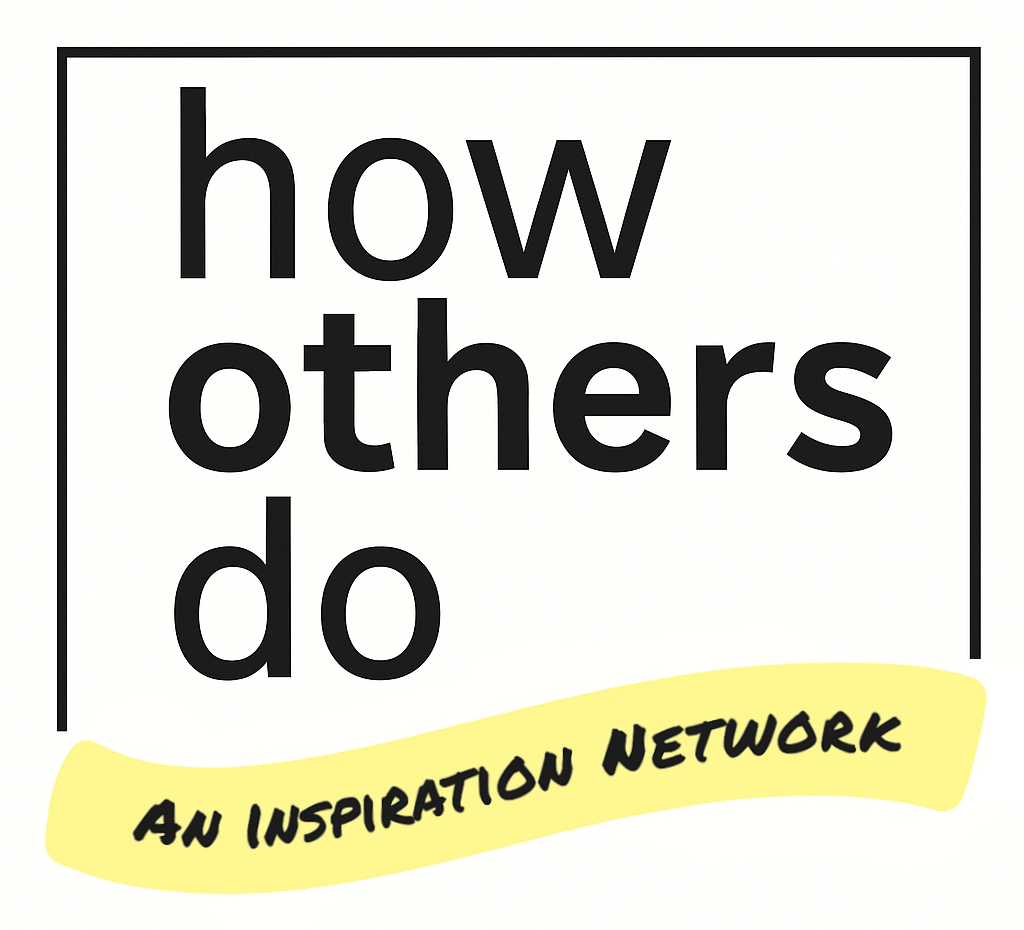Es klingt harmlos, fast schon einfach. Zwei Betriebssysteme für meine Organisation, die parallel laufen: Ein etabliertes Betriebssystem für die Aufbauorganisation: stabil, strukturiert, kontrollierbar. Und daneben ein agiles Betriebssystem für alles, was schneller, flexibler und kundenorientierter werden soll. SAFe nennt das zum Beispiel in Anlehnung an Kotter „das duale Betriebssystem“. Agilität ohne großen Umbau. Transformation ohne Kontrollverlust. Struktur bleibt und Bewegung kommt dazu.
Jetzt ist der Kerngedanke von Kotter nicht grundsätzlich falsch. Sondern leider wird es fast immer falsch verstanden bzw. auch falsch verkauft. Die Idee eines zweiten Betriebssystems wird interpretiert als Freifahrtschein für Nicht-Veränderung. „Wir lassen alles wie es ist – und führen SAFe ein.“ Klingt gut. Funktioniert nie.
Der Preis des Parallelbetriebs
Was auf dem Reißbrett logisch wirkt, wird in der Praxis zur ’systemischen Schizophrenie‘. Die Organisation spaltet sich in zwei Denkmodelle. Das eine spricht über Ressourcen, Linienführung und Budgethoheit. Das andere über Value Streams, Kundennutzen und iterative Wertschöpfung. Beide Systeme folgen eigenen Regeln, doch sie teilen dieselben Menschen, Prozesse und Projekte. Das Ergebnis: Reibung, Rollenkonflikte und Entscheidungslücken.
Das ‚Viable System Model‘, kurz VSM, beschreibt exakt dieses Phänomen. Es zeigt, wie Organisationen nur dann lebensfähig bleiben, wenn Steuerung, Koordination und Umsetzung systemisch integriert sind. In vielen SAFe-Umfeldern passiert aber genau das Gegenteil: Das agile Betriebssystem wird übergestülpt, ohne die darunterliegende Struktur zu hinterfragen. Es entstehen zwei Systeme, die gegeneinander arbeiten und nicht miteinander.
Wenn die Matrix zur Falle wird
Die Folge: eine Matrixstruktur, die nicht mehr führt, sondern lähmt. Fachliche Verantwortung liegt in agilen Rollen und disziplinarische Macht bleibt in der Linie. Führungskräfte wissen nicht, ob sie Product Owner fördern oder ihre alte Hierarchie absichern sollen. Mitarbeitende fragen sich, ob sie Karriere im Team oder in der Organisation machen. Entscheidungen werden doppelt getroffen, oder gar nicht. Die Matrix verspricht Verbindung, liefert aber Blockade.
Solche Systeme wirken schizophren, weil sie es sind. Sie erzeugen Widersprüche, die sich nicht mehr durch Kommunikation lösen lassen, sondern nur durch strukturellen Umbau. Das duale Betriebssystem ist kein stabiler Zustand. Es ist eine Übergangsform und maximal wenige Monate tragbar. Danach muss die Organisation entscheiden, wer sie sein will.
Praxisfall: Agil eingeführt, Hierarchie behalten
Hier ein aktuelles Beispiel aus meiner erlebten Praxis:
Ein großes mittelständisches Unternehmen aus dem Süden Deutschlands entscheidet sich für SAFe. Aus Abteilungen werden ARTs. PI Plannings werden organisiert. Neue Rollen eingeführt. Alles scheint auf dem Papier agil, bis die Realität zurückschlägt.
Die alten Linienorganisationen bleiben bestehen – faktisch unangetastet. Führungskräfte behalten ihre Positionen, übernehmen aber nun zusätzlich Rollen im agilen System. Viele agieren weiter wie vorher, nur mit neuem Titel. Die Aufbauorganisation schlägt die Ablauforganisation in fast jedem Meeting. Entscheidungen werden vertagt, eskaliert oder ignoriert, weil die wahre Macht noch immer entlang der alten Struktur verläuft.
Am sichtbarsten wird das bei den Rollen von Product Owner und Product Manager. Statt End-to-End-Verantwortung entstehen parallele Realitäten: Es gibt weiterhin einen PO für das Business parallel zu dem PO in der IT. Wert wird nicht entlang des Kundenflusses organisiert, sondern entlang von Ressorts, Budgets und Befindlichkeiten. Was fehlt, ist das verbindende Element: ein echtes gemeinsames Produktverständnis.
Positives Beispiel: Erst der Wertstrom, dann das Framework
Ein Automobilhersteller geht einen anderen Weg. Nicht SAFe als Framework steht im Mittelpunkt, sondern die digitale Produktorganisation, kurz DPO. Der Umbau beginnt nicht mit Trainings, sondern mit einer Entscheidung: Wir bauen Wertströme, nicht Organigramme.
Business und IT werden gemeinsam neu gedacht. Rollen werden nicht nur eingeführt, sondern mit echten Verantwortlichkeiten ausgestattet. Karrierepfade im Ablauf- und Aufbaubetrieb werden synchronisiert. Wer Verantwortung übernimmt, kann aufsteigen, unabhängig davon, ob die Rolle „Teamleiter“ oder „Product Owner“ heißt. Das erfordert Mut, Klarheit und ein neues Verständnis von Führung.
Das Ergebnis: weniger Machtspiele, mehr Fokus auf den Kundennutzen. SAFe wird zum Werkzeug und nicht zur Fassade. Das Betriebssystem bleibt nicht dual, sondern wird eins.
Zugegeben: Läuft dort alles 100% nach Plan und ohne Reibungen? Natürlich nicht, auch in diesem Fall gibt es bei dem Automobilhersteller viele Baustellen, Herausforderungen und weiterhin hierarchische Konflikte. Aber diese werden sichtbar, gezielt adressiert und weiterentwickelt.
Die Matrix auflösen oder darin untergehen
Wenn Steuerung, Verantwortung und Kommunikation nicht kohärent sind, wird jede noch so gut gemeinte Agilisierung zur Showbühne. Die Symptome sind bekannt:
- Führungsrollen, die sich widersprechen.
- Entscheidungen, die eskalieren.
- Teams, die zwischen zwei Systemen zerrieben werden.
- Effizienz, die nicht gehoben wird.
Was hilft, ist kein weiteres Framework, sondern das Auflösen der Matrix. Klarheit in Zuständigkeiten. Führung entlang des Flusses. Rollen statt Titel. Verantwortung, die sichtbar ist und das nicht nur im Organigramm, sondern im Alltag.
Die passenden Muster aus how others do
Was hier fehlt, ist kein Tool. Es fehlen Muster, die systemisch wirken und nicht kosmetisch.
- Problem Pattern #1 „Silostrukturen“: Abteilungen und Teams arbeiten nebeneinander statt miteinander.
- Problem Pattern #5 „Unklare Rollen & Zuständigkeiten“: Rollen sind nicht klar definiert oder werden nicht gelebt.
- Solution Pattern #1 „Flow-Orientierung“: Wertschöpfung wird entlang echter Kundenflüsse organisiert – nicht entlang der Aufbauorganisation.
- Solution Pattern #2 „Strategie-Alignment“: Aufbau- und Ablauforganisation folgen
einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung. - Solution Pattern #5 „Eindeutige Rollen & Zuständigkeiten“: Verantwortung ist sichtbar, verbindlich und unabhängig vom Titel.
Erste Schritte: Vom Parallelbetrieb zur echten Transformation
Wer das duale Betriebssystem ernst meint, muss es auch weiterdenken.
- Der erste Schritt ist, Wertschöpfung wirklich sichtbar zu machen – nicht in Organigrammen, sondern entlang konkreter Kundenflüsse. Solange unklar ist, wo und wie Wert entsteht, bleibt jede Strukturdebatte theoretisch.
- Im zweiten Schritt braucht es eine klare Klärung von Rollen und Verantwortung. Neue Titel allein verändern nichts. Entscheidend ist, wer in der Praxis entscheidet und wer Verantwortung auch wirklich trägt.
- Ebenso wichtig ist, dass Strategie und operative Arbeit miteinander verbunden werden. Wenn Aufbau- und Ablauforganisation unterschiedliche Ziele verfolgen, entsteht keine gemeinsame Richtung.
- Auch Führungsrollen gehören auf den Prüfstand. Wenn Fach- und Linienführung gegeneinander arbeiten, entsteht Unsicherheit statt Orientierung. Führung muss dort stattfinden, wo Wirkung entsteht und nicht dort, wo Macht historisch verankert ist.
Und zuletzt: Ein Parallelbetrieb darf kein Dauerzustand sein. Er ist eine Übergangsphase. Mehrere Monate können sinnvoll sein und länger hält ihn kaum eine Organisation aus, ohne Schaden zu nehmen. Spätestens dann braucht es eine klare Entscheidung, welches Betriebssystem in Zukunft tragen soll.
Fazit
Das duale Betriebssystem ist kein bequemes Paralleluniversum. Es ist eine Phase und keine Lösung. Wer es einführt, muss es umbauen. Wer es beibehält, spaltet seine Organisation in widersprüchliche Logiken. Die einen sprechen von Agilität und die anderen von Berichtslinien. Was dabei rauskommt, ist keine Transformation. Es ist systemische Schizophrenie.
Die Matrix muss aufgelöst werden. Nicht aus dogmatischen Gründen, sondern aus funktionalen. Nur so entsteht ein Betriebssystem, das den Namen verdient: integriert, kohärent, lebensfähig.
Kapieren statt kopieren.